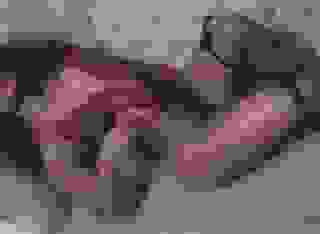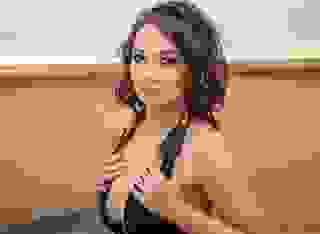- Romanze
- Der Olivenhain
Hinweis: Sie können die Schriftgröße und das Schriftbild ändern und den Dunkelmodus aktivieren, indem Sie im Story-Infofeld auf die Registerkarte "A" klicken.
Sie können während unseres laufenden öffentlichen Betatests vorübergehend zu einem Classic Literotica® Erlebnis zurückkehren. Bitte erwägen Sie, Feedback zu Problemen zu hinterlassen oder Verbesserungsvorschläge zu machen.
Klicke hier„Signorina Hertig? Signorina Greta Hertig?"
Ein älterer Mann hat gerade den Friseursalon betreten und kommt geradewegs auf mich zu. Ich habe ihn noch nie gesehen. Was will der von mir? Woher kennt er meinen Namen? Ein Mann kommt höchst selten allein zum Damenfriseur. Entweder er begleitet seine Frau oder es ist ein Vertreter für irgendwelche Produkte. Doch dieser passt gar nicht hierher. Er ist klein und dicklich, trägt einen Hut und ist vornehm gekleidet.
„Was wollen Sie?", stelle ich eine Gegenfrage. Ich bin zugegebenermaßen etwas unfreundlich. Der Mann nervt.
„Wenn Sie signorina Greta Hertig sind, dann suche ich Sie", antwortet er.
„Was wollen Sie von mir? Ich kenne Sie nicht!"
Er lächelt väterlich und wirkt, wie aus einer anderen Welt. Ein wenig aristokratisch, etwas abgehoben, würde ich sagen. Auf jeden Fall fällt er auf, hier in Neukölln. Es ist nicht gerade die noble Gegend, in der man einen Mann wie ihn erwarten könnte.
„Können wir irgendwo ungestört sprechen?", meint er.
„Sie sehen doch, ich bin alleine und muss mich um die Kundin kümmern. Meine Chefin ist heute nicht da. Sie können von mir aus in der Mittagspause wiederkommen, wenn Sie unbedingt wollen", antworte ich.
„Wann haben Sie Mittagspause?", erkundigt er sich. Trotz meiner harschen Art bleibt er zuvorkommend.
„Um halb eins schließen wir den Laden."
„Danke, sehr freundlich. Dann komme ich um halb eins. Auf Wiedersehen!", grüßt er.
Der Mann deutet eine Verbeugung an, zieht den Hut und macht auf dem Absatz kehrt. Während ich ihm nachdenklich nachschaue und sich die Tür langsam hinter ihm von selbst schließt, läutet die Küchenuhr, die mir anzeigt, dass ich die Tönung aus den Haaren der Kundin waschen muss und eile zur ihr.
Ich habe die ganze Zeit das Hirn zermartert, was dieser Typ wohl von mir will. In letzter Zeit habe ich wirklich nichts angestellt. Ich hatte mit niemandem Streit und Schulden habe ich auch keine. Allerdings sieht der Mann weder wie ein Polizeibeamter, oder Gerichtsvollzieher und schon gar nicht wie ein Schuldeneintreiber aus. Die Sache ist mehr als rätselhaft.
Zehn Minuten vor der Zeit steht er wieder im Geschäft. Er sagt kein Wort und wartet geduldig neben dem Eingang, bis ich die letzte Kundin abkassiert und zur Tür gebracht habe. Ich sperre hinter ihr ab.
„Ungestörter als hier können wir nicht sein", eröffne ich ihm. Gleichzeitig biete ich im Platz auf einem der Friseurstühle an.
Er schaut sich etwas pikiert um. Der feine Herr scheint meinen saloppen Umgang nicht gewohnt zu sein. Ist wohl etwas Besseres? Trotzdem nimmt er auf dem ihm angebotenen Stuhl Platz. Ich ziehe währenddessen meinen Kittel aus und hänge ihn über die Lehne eines zweiten Stuhles. Er beobachtet mich dabei genau.
Was unter dem Kittel zum Vorschein kommt scheint ihm nicht wirklich zu gefallen. Er mustert von oben bis unten und zieht dabei den Mund etwas nach oben. Er schaut einen Moment nicht besonders glücklich drein, lässt sich von meinem schwarzen Outfit aber doch nicht ganz aus der Bahn werfen. Sein Gesicht kehrt sofort zu seinem nichtssagenden Ausdruck zurück.
Ich bin wahrlich keine Modepuppe. Das könnte ich mir von meinem schmalen Gehalt als Friseurin auch gar nicht leisten. Ich mag schwarze Kleidung, auch wenn ich daraus keine Ideologie mache. Ich mag es eben dunkler und unscheinbar. Ich trage eine löchrige Strumpfhose, dicke klobige Schuhe, einen Ledermini und ein Sweatshirt. Alles schwarz natürlich. Nur eine rote Strähne in meinem sonst schwarzen Haar gibt dem Gesamtbild einen Farbtupfer.
„Was soll ich ausgefressen haben?", frage ich. Mein Ton ist immer noch unfreundlich.
„Nein, nein! Sie haben nichts ausgefressen", wehrt er ab. Meine Frage scheint ihn zu überraschen. „Wäre es Ihnen möglich, sich auszuweisen?"
„Ich soll mich was?"
„Ich müsste mich vergewissern, dass Sie wirklich Greta Hertig sind, geboren am 22.Dezember 1995 in Berlin", entschuldigt er sich.
„Wer sind Sie überhaupt, dass Sie das wissen wollen. Sie haben sich noch nicht vorgestellt", protestiere ich zickig.
„Verzeihen Sie, signorina. Sie haben völlig Recht, wie unhöflich von mir", antwortet er. Ich sehe ihm an, dass ihm sein Versäumnis furchtbar peinlich ist. „Ich bin Renato Domodossola."
„Aha, Renato Domo-was bitte?"
„Renato Domodossola, ich bin Notaio in Florenz. Wie sagt man bei Ihnen?"
„Notar? Sind Sie ein Notar?"
„Genau, danke, ich bin Notar."
„Was wollen Sie von mir. Florenz ist ein ganz schönes Stück weit weg. Sind Sie sicher, dass Sie zu mir wollen?"
„Wenn Sie Greta Hertig sind, dann will ich zu Ihnen", bestätigt er.
Notar passt zu ihm. Die sind doch so steif und genau. Doch was habe ich mit einem Notar zu schaffen? Wenn ich das erfahren will, muss ich mich wohl oder übel ausweisen.
„Moment, ich muss meine Handtasche holen", informiere ich ihn.
Ich mache mich auf den Weg in den Umkleideraum und hole meine Handtasche. Zum Glück habe ich heute meine Geldtasche dabei. Es gibt Tage, an denen ich sie zu Hause vergesse, weil ich es eilig habe und nicht mehr daran denke. Zurück im Salon nehme ich den Perso heraus und reiche ihn dem Notar.
Er nimmt ihn, bedankt sich und kontrolliert die Daten. Anschließend gibt er mir den Ausweis zurück.
„Sie sind Greta Hertig", stellt er fest.
„Das habe ich die ganze Zeit gesagt!", gebe ich Kontra.
„Verzeihen Sie, es geht nicht darum, dass ich Ihnen nicht glaube. Ich muss mich an meine Vorschriften halten und sicher sein, dass ich mit der richtigen Person spreche", verteidigt er sich.
„Schon gut", wiegle ich ab.
„Wie gesagt, ich muss sicher sein", wiederholt er sich. „Also, signorina Hertig, ich muss Ihnen die traurige Mitteilung überbringen, Ihr Vater ist verstorben."
Ich schaue ihn überrascht an. Was soll das jetzt? Damit erzählt er mir wahrlich nichts Neues.
„Das hätte ich auch ohne das ganze Theater gewusst", antworte ich genervt. „Der hat schon vor vielen Jahren im Suff den Löffel abgegeben."
„Ich meine Ihren leiblichen Vater", stellt der Notar klar. Man sieht ihm an, dass ihn meine lockere Ausdrucksweise irritiert.
„Mein leiblicher Vater? Machen Sie Witze?"
„Glauben Sie mir, ich mache keine Scherze, vor allem nicht bei so einem Thema."
„Mein Vater ist 2011 volltrunken gegen einen LKW gebrettert. Mit dem Fahrrad! Er war auf der Stelle tot. Doch keine Sorge, es war kein sonderlich großer Verlust für die Menschheit."
„Das war nicht Ihr leiblicher Vater", beharrt er.
„Wie, nicht mein leiblicher Vater? Ich habe keine zwei Väter, das wüsste ich."
„Ihr leiblicher Vater lebte in der Nähe von Siena. Glauben Sie mir doch", versichert er mir.
Er kramt in seiner ledernen Aktentasche und holt ein altes Briefkuvert hervor und reicht es mir. Der Umschlag ist stark abgegriffen und es sind viele dunkle Fingerabdrücke darauf. Der Brief muss oft in die Hand genommen worden sein.
„Bitte, lesen Sie selbst!"
Irritiert nehme den Umschlag entgegen und betrachte ihn überrascht. Unsicher schaue ich hinein, es steckt ein Blatt Papier drinnen. Ich ziehe es heraus.
„Darf ich lesen?", frage ich.
„Nur zu, dazu haben ich Ihnen den Brief gegeben."
Ich falte das Blatt auseinander. Darauf stehen einige zittrig geschriebene Zeilen. Die Handschrift erkenne ich sofort. Es ist die meiner verstorbenen Mutter.
Liebster Giuseppe,
ich hoffe, du bist mir nicht mehr böse. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich hoffe gut. Ich werde unsere gemeinsamen Wochen in Siena nie mehr vergessen. Du wirst immer in meinem Herzen bleiben. Wer weiß was aus uns geworden wäre, hätten wir uns unter anderen Umständen getroffen.
Nimm es mir bitte nicht übel, dass ich nicht den Mut aufbringe, alle Brücken hinter mir abzubrechen und mit dir irgendwo auf der Welt ein neues Leben zu beginnen. Nicht bei diesen Voraussetzungen.
Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, mich nie mehr bei dir zu melden, um es dir nicht allzu schwer zu machen. Ich hoffe innständig, dass du mich eines Tages vergessen kannst. Wir hatten eine wunderschöne Zeit zusammen. Doch leider kann es keine gemeinsame Zukunft für uns geben.
Allerdings kann und will ich dir nicht verschweigen, dass ich schwanger bin. Ich werde das Kind zur Welt bringen. Dein Kind! Ich habe lange überlegt, ob ich es dir sagen soll. Es würde mir zu sehr auf der Seele lasten, würde ich es dir verheimlichen.
Mach dir keine Sorgen, das Kind muss nicht ohne Vater aufwachsen. Ich habe Hans, einen ganz anständigen Mann kennengelernt. Er hat um meine Hand angehalten und ich habe ´Ja´ gesagt. Das Kind soll und muss einen Vater haben. Er ahnt nicht, dass es nicht sein Kind ist und wird es lieben, wie sein eigenes.
Lebe wohl Giuseppe und such nicht nach mir
Deine dich immer liebende Maria
Ich bin baff. Die Handschrift ist eindeutig die meiner Mutter. Die Worte sind ausgesprochen zittrig, doch angesichts dessen, was sie schreibt, wundert es mich nicht. Meine Mutter hat Maria geheißen. Auch die etwas holprige Ausdrucksweise könnte passen. Das muss meine Mutter geschrieben haben!
Ich weiß nicht, was ich denken soll. Meine Gedanken schweifen ab. Mir kommt ein Verdacht. Kann es sein, dass mein Vater entdeckt hat, dass ich nicht seine Tochter bin? Hat er deshalb mit dem Trinken angefangen? War er deshalb so abweisend? Die Geschichte meiner Familie steht plötzlich in einem ganz neuen Licht da. Alles war eine einzige kolossale Lüge.
„Ist das wirklich wahr?", frage ich. Ich kann es immer noch nicht glauben.
„Endgültige Klarheit würde wohl nur ein Vaterschaftstest bringen. Ihr Vater allerdings war überzeugt davon."
Ich setze mich auf den zweiten Sessel. Ich muss diese Informationen verdauen. Man erfährt nicht jeden Tag, dass der Vater gar nicht der Vater ist, dass dafür aber ein anderer der Vater war.
„Siena? Florenz? Was hatte meine Mutter mit Italien zu tun?"
Wieder kramt er in seiner Tasche und zieht einen zweiten Brief hervor. Diesmal ist es ein makellos weißer Umschlag.
„Ihr Vater hat mir diesen Brief für Sie gegeben."
Ich nehme ihn. Nachdenklich betrachte ich den Umschlag ohne ihn jedoch zu öffnen. Am Rande fällt mir auf, dass es kein normales Briefpapier ist. Es ist Pergament, Büttenpapier oder wie man das Zeug nennt. Ich kenne mich damit nicht aus. Das Papier ist mit einem Wasserzeichen versehen. Ich vermute, dass es sich um das Wappen der Familie handelt. So einen vornehmen Brief bekommt man als einfaches Berliner Mädchen nicht oft zu Gesicht.
Das Papier ist mir im Augenblick egal. Mich interessiert vielmehr der Inhalt. Allerdings traue ich mich nicht, ihn zu öffnen und zu lesen. Nicht im Augenblick zumindest. Ich habe soeben einen Brief gelesen, der meine Welt komplett auf den Kopf gestellt hat. Im Moment weiß ich nicht mehr, wer ich bin und was ich denken soll. Was steht in diesem Brief? Wird er mir Antworten auf alle meine Fragen geben? Wird er noch mehr Fragen aufwerfe?
„Öffnen Sie doch den Brief. Er ist an Sie adressiert", fordert mich der Notar auf.
„Kann ich ihn auch später lesen? Wenn ich alleine bin?"
Ich fühle mich kraftlos und verletzlich. Am liebsten würde ich mich in einem Loch verkriechen und möchte am liebsten für mich alleine sein. Was ich gerade erfahren habe, hat mir regelrecht den Boden unter den Füßen weggerissen. Ich weiß nicht mehr woher ich komme und wer ich bin. Ich habe mir eingebildet, ein taffes Mädchen zu sein. Doch das ist zu viel.
„Ja natürlich. Ich würde Sie nur bitten, mich in den nächsten Tagen anzurufen. Ich muss die Testamentseröffnung vorbereiten", antwortet er.
„Was hat das mit mir zu tun?", erkundige ich mich.
„Ihr Vater hat Sie im Testament bedacht. Sie müssten bei der Eröffnung anwesende sein", erklärt er.
Der Notar nimmt eine Visitenkarte aus der Tasche, schreibt etwas drauf und reicht sie mir.
„Ich habe ihnen meine Handynummer draufgeschrieben. Rufen Sie mich bitte direkt an. Meine Sekretärinnen sprechen kein Deutsch. Zögern Sie nicht. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich. Dazu bin ich da."
„Ich werde Sie anrufen", verspreche ich.
„Schönen Tag noch signorina Hertig. Ich kann gut verstehen, dass Sie Zeit brauchen, um diese Neuigkeiten sacken zu lassen", meint er. "Bemühen Sie sich nicht, ich finde selbst hinaus."
Ich rufe meine Chefin an und bitte Sie, mir den Nachmittag frei zu geben. Ich gaukle ihr vor, mir sei übel und ich hätte wohl einen Virus eingefangen. Von dem, was gerade vorgefallen ist, erwähne ich nichts. Im Augenblick kann ich mit der neuen Situation selbst noch nicht umgehen. Wie soll ich es dann einem anderen erklären.
Zu Hause in meiner kleinen Wohnung sitze ich auf meinem Bett und halte den Brief in der Hand. Ich denke nur nach und bewege mich kaum. Die Zeit verrinnt zäh. Mir schwirren tausende Gedanken durch den Kopf und trotzdem kann ich keinen klaren Gedanken fassen.
Ich finde die längste Zeit nicht den Mut, den Brief endlich aufzureißen und ihn zu lesen. Das wäre sicher der schnellste Weg Licht in die Angelegenheit zu bringen. Stattdessen starre ich stupide auf die Visitenkarte und lese zum tausendsten Mal, was draufsteht. Inzwischen kenne ich sie auswendig. Es ist nur eine Ablenkung, um nicht an die eigentliche Frage zu denken.
Wer war mein Vater? Um mich herum bricht gerade alles zusammen. Was soll ich überhaupt noch glauben? Ich habe das Gefühl, die wenigen Worte und Nummern auf diesem winzigen Stück Papier sind im Augenblick die einzigen Dinge, die in meinem Leben noch echt sind.
Den Notar habe ich gesehen und er ist real. Alles andere ist offenbar nicht das, was es bisher zu sein schien. Meine Mutter und vermutlich auch der Bastard von meinem Vater haben mich ein Leben lang belogen. Beide sind tot und ich stehe da, mit meinen Fragen, mit meinen Zweifeln, mit meiner Unsicherheit. Möglicherweise war mein Vater gar nicht der Bastard, für den ich ihn ein halbes Leben lang gehalten habe.
Plötzlich habe ich einen leiblichen Vater, den ich nie gesehen habe. Auch er ist tot. Auch ihn kann ich nicht fragen. Ich bin es mein Leben lang gewohnt, mich alleine durchs Leben zu schlagen. Mein Vater war ein Säufer und auch meine Mutter war mir nie eine große Hilfe. Seit ihrem Tod bin ich sowieso allein. Ich konnte mich immer selbst behaupten. Aber im Augenblick wünsche ich mir nur einen Menschen, an den ich mich anlehnen kann. Jemand, der für mich da ist.
Es dämmert bereits. Es hilft nichts. Ich will endlich Klarheit haben. Egal was im Brief steht, ich muss ihn lesen. Nur so weiß ich, was drinnen steht. Vorsichtig, fast schon andächtig, öffne ich den Umschlag. Ich zögere kurz, bevor ich das Schreiben herausnehme und ganz langsam entfalte. Soll ich ihn wirklich lesen? Ich muss wohl!
Mein liebes Kind,
wenn du diesen Brief in Händen hältst, bin ich bereits tot. Leider hatten wir nicht mehr die Möglichkeit, uns persönlich kennen zu lernen. Ich wusste lange nicht, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist. Das hat mir deine Mutter nie gesagt. Dass es dich gibt weiß ich lediglich aus einem Brief, den sie mir vor vielen Jahren geschrieben hat. Seitdem habe ich nie mehr etwas von deiner Mutter gehört.
Ich habe mich bemüht, Nachforschungen anzustellen. Doch deine Mutter hatte inzwischen geheiratet, den Namen geändert, ist umgezogen. Damit hat sich ihre Spur verloren. Ich hätte dich so gern getroffen, gesehen, was für ein Mensch du bist und Zeit mit dir verbracht. Es ging leider nicht mehr. Es ist für mich ein kleiner Trost, dass dich mein Notar gefunden und dir diesen Brief übergegeben hat. Damit erfährst du zumindest, dass es mich gegeben hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dir deine Mutter nie etwas von mir erzählt hat.
Du wirst dich fragen, warum du einen Vater in Italien hast. Deine Mutter ist nach Siena gekommen und hat hier einen Sprachkurs besucht. Dabei haben wir uns zufällig kennengelernt und in einander verliebt. Sie war ein wunderbares Mädchen. Noch heute vergeht kein Tag, ohne dass ich an sie denke. Glaube mir bitte, ich habe deine Mutter wirklich geliebt und bis an mein Lebensende nicht mehr damit aufgehört.
Sieben wunderschöne Wochen durften wir zusammen verbringen. Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, so war dies die glücklichste Zeit. Versteh mich bitte nicht falsch, ich hatte ein wirklich schönes Leben. Allerdings die Zeit mit deiner Mutter überstrahlt alles.
So groß unsere Liebe auch war, sie stand von Anfang an unter keinem guten Stern. Während deine Mutter damals noch blutjung war, war ich bereits Anfang Vierzig. Noch dazu war ich verheiratet und hatte drei Kinder. Zwei eigene und eines hat meine Frau in die Ehe mitgebracht. Es war eine sehr verzwickte Situation.
Deine Mutter hat bei uns auf dem Weingut gewohnt und bei der Arbeit mitgeholfen. Das hat es uns leicht gemacht, viel Zeit miteinander zu verbringen. Meine Frau und die Kinder haben sich nie für das Weingut interessiert und leben auch heute noch in der Stadt.
Ich wäre bereit gewesen, alles hinter mir zu lassen und mit deiner Mutter ganz neu anzufangen. Doch deine Mutter war wohl die Vernünftige von uns beiden. Sie hatte Angst davor, ich würde es eines Tages bereuen, ihretwegen meine Familie verlassen zu haben. Sie zog es vor, unsere Zeit als glücklichen Abschnitt im Leben in Erinnerung zu behalten, als zu erleben, dass unsere Liebe an diesem Problem zerbricht.
Ich war der heißblütige Italiener und sie die besonnene Deutsche. Sie hat die Entscheidung für uns beide getroffen und ließ nicht mehr mit sich reden. Es war für mich ein sehr schwerer Abschied. Hätte ich damals gewusst, dass Maria alle Brücken hinter sich abreißt und wir uns nie wiedersehen, ich hätte sie nicht gehen lassen. Vor allem nicht, wenn ich damals schon gewusst hätte, dass unsere Liebe etwas so Wunderbares wie dich hervorbringen würde.
Heute bin ich ein einsamer, alter Mann. Meine Frau und ich haben nichts mehr gemeinsam. Auch meine Kinder sehe ich kaum noch. Sie leben in der Stadt, ich dagegen bin auf meinem geliebten Landgut. Wohl auch deshalb, weil mich hier alles an deine Mutter erinnert. Hier fühle ich mich ihr näher, als an jedem anderen Ort der Welt.
Ich hatte ein erfülltes Leben. Keine Frage! Allerdings blieb es mir verwehrt, dich kennenzulernen und deine Mutter noch einmal in die Arme zu schließen. Das wäre das Schönste gewesen, was mir hätte passieren können. Wie gerne hätte ich Euch beide in die Arme genommen. Dieses Versagen wirft einen Schatten der Wehmut über mein ganzes Leben.
Ich bin allein und verbringe viele Stunden im uliveto, dem Olivenhain. Dort hat sich deine Mutter so gerne aufgehalten. Es war ihr Lieblingsplatz. Ich habe eigens für sie dort eine Bank aufstellen lassen, die heute noch dort steht. An manchen Tagen sitze ich stundenlang dort und sehne mich nach der Zeit zurück.
Auf dieser Bank ist auch mein Wunsch gereift, dir das Weingut zu vererben. Es ist das, was mich und deine Mutter zusammengebracht und mich mein halbes Leben lang an sie erinnert hat. Du wirst dich jetzt fragen, was du mit einem Weingut anfangen sollst. Ich nehme an, dass ein junges Mädchen aus Berlin wenig Ahnung vom Weinbau hat.
Trotzdem bitte ich dich, das Erbe anzunehmen und das Weingut weiterzuführen. Der Kellermeister und das restliche Personal werden dir genauso treu ergeben sein, wie mir. Mit ihrer Hilfe wirst du es schaffen. Davon bin ich überzeugt.
Mit dieser Bitte und einem wehmütigen Lebewohl beschließe ich diesen Brief, meine einzigen Worte, die ich je an dich richten durfte.
Dein Vater Giuseppe Pisolo
Ich weiß nicht was ich sagen soll. Tränen rinnen über meine Wangen. Ich bin unendlich traurig. Ich konnte den Brief nur Absatz für Absatz lesen und musste die Worte einzeln auf mich wirken lassen. Mein Vater hat sehr darunter gelitten, dass er meine Mutter nie wiedergesehen hat. Auch mich scheint er ehrlich vermisst zu haben. Ich habe selten so emotionale Worte gelesen. Mein leiblicher Vater muss ein außergewöhnlicher Mann gewesen sein.
Ich lese die Zeilen mehrmals. Ich sauge den Inhalt förmlich in mich hinein. Aus jedem Wort spüre ich die Liebe, die er meiner Mutter entgegengebracht hat und wie sehr er sich danach gesehnt hat, mich in den Arm zu schließen. Ich kann mir gut vorstellen, wie schwer es für ihn gewesen sein muss zu wissen, dass er ein Kind hat, es aber nicht sehen konnte. Ich glaube, es wäre besser gewesen, meine Mutter hätte ihm nie geschrieben, dass es mich gibt.