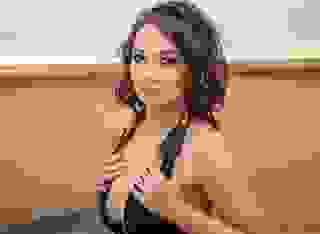- BDSM
- Ich Wünschte...
- Seite 3
Hinweis: Sie können die Schriftgröße und das Schriftbild ändern und den Dunkelmodus aktivieren, indem Sie im Story-Infofeld auf die Registerkarte "A" klicken.
Sie können während unseres laufenden öffentlichen Betatests vorübergehend zu einem Classic Literotica® Erlebnis zurückkehren. Bitte erwägen Sie, Feedback zu Problemen zu hinterlassen oder Verbesserungsvorschläge zu machen.
Klicke hierIch kam mir danach ziemlich blöd vor und ärgerte mich wieder über mich. Wieder so eine Situation, in der ich nicht souverän agiert hatte. Ich versuchte mir einzureden, dass ich nur das getan hatte, was ohnehin schon klar gewesen war und damit so gehandelt hatte, wie man das von jemandem erwartet in meiner Position. Aber das war nur ein schwaches Argument, und ich war selbst davon nicht überzeugt.
Mehr beschäftigte mich nun die Frage, wie ich von da an mit ihr umgehen sollte, wenn sich unsere Wege kreuzten. Konnte ich wieder zum Ignorieren zurück? Sollte ich sie von nun an immer grüßen? Es war einfach ärgerlich. Ich kam zu dem Ergebnis, dass ich bei der nächsten Begegnung einfach ihren Blick suchen und ihr die Reaktion überlassen würde. Aber auch das war nicht besonders geschickt. Immerhin übergab ich ihr damit das Heft des Handelns, dabei wollte ich doch diejenige sein, die die Kontrolle behielt.
Am nächsten Tag sah ich sie in einem Gang verschwinden, als ich aus dem Lehrerzimmer kam. Es war nicht wirklich ein Vorwand, der mich dazu brachte, ihr zu folgen. Seit Wochen schon wollte ich in den Abstellraum gehen, weil ich einen Satz Bücher suchte, die da sehr wohl sein konnten.
Aber als ich in den Gang einbog, war sie schon irgendwohin verschwunden.
Natürlich waren die Bücher nicht in dem Abstellraum. Später ärgerte ich mich über mein Verhalten, aber in diesem Augenblick drehte ich mich nur einige Male sinnlos im Kreis und verließ den staubigen Raum wieder.
Als ich heraus kam, erschrak ich.
„Verfolgen Sie mich?"
Liz lehnte betont lässig an der Wand.
„Was?"
„Verfolgen. Wie so ein Stalker. Sie kennen das doch. Diese Leute, die anderen Leuten hinterher rennen, sie belauschen, Psychoterror ausüben. Stalken."
„Was?"
„Stalken Sie mich?"
Ich fühlte mich ertappt. Das Blut stieg mir zu Kopf. Es war albern. Was hatte ich mich zu rechtfertigen? Ich hatte sehr wohl das Recht, überall im Gebäude zu sein. Was hatte ich mich ihr gegenüber zu erklären? Aber so liefen meine Gedanken in diesem Moment nicht. Sie hatte mich erwischt. Ich rang um eine Antwort, druckste ein wenig rum, brachte das dann mit den Büchern vor, die ich suchte:
„Ich habe hier was gesucht."
Aber mittlerweile kam mir diese Lüge auch schon abgestanden vor und meine Worte kamen so tranig heraus, dass ich selbst schon nicht mehr an sie glaubte. Ich begann mich wieder über mich zu ärgern. Warum fühlte ich mich ertappt?
Weil sie mich ertappt hatte. Was gab es zu leugnen?
Aber dann löste sie die Spannung.
„War nur ein Scherz!"
Und sie grinste. Wieder dieses seltsame Lächeln, das ich nicht deuten konnte. War es spöttisch oder wollte sie Sympathie damit ausdrücken? Was wollte sie mir sagen?
Ich atmete jedenfalls auf.
Dann tat sie etwas, das mir die nächsten Tage nicht aus dem Kopf gehen sollte.
Um mir zu zeigen, dass sie es nicht böse meinte, fasste sie meinen Arm und lehnte sich ein wenig zu mir. Eine dieser vertraulichen Gesten, die man unter Freundinnen ganz selbstverständlich macht, aber eben nicht zu Fremden. Schon gar nicht in solch einer asymmetrischen Beziehung, wie sie eine Schülerin zu einer Lehrerin hatte.
Mir schien diese Berührung vollkommen fremd und deplatziert. Aber in ihrem Auftreten war keine Spur Unsicherheit oder Zögern zu erkennen. War ich einfach nur übersensibel?
„Keine Sorge, war nur ein Scherz. Sie müssen sich nicht ertappt fühlen oder so. Suchen Sie nur Ihre Bücher. Geht mich ja gar nichts an!"
Es war überraschend, und erst schreckte ich ein wenig zurück, ihre Hand auf meinem Unterarm zu spüren. Es fühlte sich seltsam an. Auf der einen Seite war ihre Hand weicher als ich erwartet hätte von ihrem in mancher Hinsicht virilen Auftreten. Auf der anderen Seite fühlte es sich wie das Kribbeln einer Spinne auf dem Arm an. Etwas, das man schnell wegwischen wollte. Aus reinem Reflex. Aber der zweite Gedanke war nicht mein eigener, es war meine Moral, die mir dieses bedrohliche Gefühl einreden wollte.
Eine Sekunde später war sie verschwunden.
Später bekam ich diese Geste nicht mehr aus dem Kopf.
Sie hatte so etwas Vertrautes, aber auch Vertrauliches. Es war eine Geste der Nähe. Wie kam sie, wie kam eine Schülerin dazu, sich mit solcher Selbstverständlichkeit und mit solchem Selbstbewusstsein mir gegenüber zu verhalten?
Ich strich über die Stelle, an der ihre Hand meinen Unterarm umfasst hatte. Ihre Hand war nicht außergewöhnlich. Schmal, schlank, eine Mädchenhand halt. Und doch musste ich den ganzen Tag über immer wieder an die Stelle greifen. Als hätte sie ein Mal hinterlassen.
Und am Abend musste ich über ihre Worte nachdenken. Sie hatte erkannt, dass sie mich ertappt hatte. Sie hatte erkannt, dass ich ein schlechtes Gewissen hatte und ihre Bemerkung zu der Suche nach den Büchern zeigte, dass sie meine Ausrede als solche identifiziert hatte.
Ich war nicht gut im Lügen, war es noch nie gewesen.
Acht
Liz ersetzte für mich das, was Hans am Ende in der anderen Stadt gewesen war. Jemand, an dessen Schicksal man Anteil nahm.
Warum sie, wo sie doch so verboten war? Eine Lehrerin stellte einer Schülerin nicht nach. Es war ein ehernes Gebot.
Ein absolutes Tabu.
Was ich an ihr mochte? Es war so vieles, und es blieb doch so vage. Was wusste man schon von einem Menschen, den man immer nur flüchtig für wenige Sekunden sah? Immer nur Fetzen und winzige Schnipsel, die man zu einem Bild zusammensetzen musste. Und jedes neues Teilchen bedeutete eine neue Facette. In all dem, was mir an ihr mysteriös vorkam, glaubte ich doch auch immer ein Stück Erkenntnis zu finden. Ich bildete mir, dass ich ihr Herr werden konnte, wenn ich sie nur entschlüsselte.
Insgeheim gab es dahinter aber noch etwas anderes.
Ich bewunderte Liz einfach. Sie strahlte solch eine Sicherheit und Souveränität aus, die man einer Neunzehnjährigen nicht zutraute. Unsicherheit, Zweifel, Hadern, all das schien ihr fremd zu sein. Wie eine Zauberin, die bereits über alle Weltmeere, alle Gebirge und durch alle Länder gereist war, erschien sie mir. Die Weltwunder bei den ersten Sonnenstrahlen gesehen hatte und gegen grimmige Zentauren gekämpft und sie bezwungen hatte. Als hätte der fahle Mond der Unterwelt ihre Haut weiß gegerbt.
Sie hatte so viel Mystisches.
Ich weiß nicht.
In ihren Augen.
So phantasierte ich.
Sie schien durch nichts zu erschüttern zu sein.
Ich bewunderte sie dafür.
Für ihre Sicherheit und das Amazonenhafte, das sie ausstrahlte.
Wäre ich doch auch so unverwundbar wie sie! Hätte ich ihre Stärke!
Obwohl ich mehr als zehn Jahre älter war, konnte ich ihr nicht das Wasser reichen.
Niedergeschrieben wirkt dies vielleicht alles albern und wie blinde Schwärmerei. Aber muss ich mich dessen schämen? Dass ich sie idealisierte? Ich wollte es nicht, und doch tat ich es.
Es waren so viele kleine Dinge an ihr.
Als ich an diesem Abend ein Glas Rotwein zu viel getrunken hatte, in meinem Sessel saß, die Beine angezogen und die Gedanken schweifen ließ, und einmal wirklich ehrlich zu mir war: Da sehnte ich mich danach, in ihren Armen zu liegen und von ihr gestreichelt zu werden. Dann würde sie meine Schmerzen und mein Unsicherheit wegwischen. Sie würde sich meiner annehmen, und ich könnte loslassen und alles fahren lassen, könnte mich treiben lassen. Ich würde mich ihr schenken und ihr die Möglichkeit geben, sich an mir zu laben. Wenn sie sich nur meiner annehmen würde. Ich würde ihr bedingungslos Zugang zu mir gewähren.
Ich sah mich, wie ich vor ihr stand. Sie saß in einem Sessel, die Arme auf den Lehnen. Wie eine Herrscherin trotz ihrer abgerissenen Gothic-Klamotten, die mehr grau als schwarz verwaschen waren. Obwohl es dunkel war, leuchteten ihre Augen in der Nacht.
Sie würde mir mit einer lässigen Handbewegung gebieten. Und ich würde gehorchen. Ich würde vor ihr knien. Den Kopf gesenkt und den Blick auf ihre Schuhe gerichtet, auf die Converse mit den Totenköpfen.
Sie würden leicht wippen. Zu einer Musik, die sich in ihrem Kopf abspielte. Irgendwas Bizarres, das ich nicht kannte.
Sie ließe mich dort warten in meiner Demut, bis es ihr beliebte, sich mir zu widmen. Ich genoss dieses Warten, denn es zeigte, wie geduldig ich war und wie ergeben ich ihr war. Sie würde stolz sein auf mich, und ich würde stolz sein, dass sie es auf mich war.
Ich würde einfach dort knien und darauf warten, dass sie etwas anderes befahl. Wenn ich nur weiterhin zu ihren Füßen sein durfte.
So dachte ich an diesen Abend in meinem Sessel nach einer Flasche Rotwein.
Waren diese Gedanken frevelhaft?
Sie waren es.
Es kümmerte mich in diesem Moment nicht.
Es scherte mich nicht, ich schämte mich nicht. Und ich schämte mich auch nicht meiner Finger, die ich über meinen Körper gleiten ließ in der unerhörten Wunschvorstellung, dass es ihre waren.
Neun
Am nächsten Tag tat sie es dann.
Ich hatte bis spät Unterricht, danach noch ein etwas unangenehm verlaufendes Elterngespräch. Es war ein langer Tag.
Als ich schließlich um fünf Uhr zu meinem Auto auf dem Parkplatz kam, sah ich sofort, was los war. Der linke Vorderreifen war platt.
Scheiße!
Wir hatten einen mysteriösen Reifenstecher an unserer Schule. Er hatte schon die Reifen einiger Kollegen aufgeschlitzt. Das hatte für große Empörung im Lehrerzimmer gesorgt. Ich hatte das eigentlich nie so richtig mitbekommen. Bis jetzt hatte es immer die Kollegen getroffen, die es vielleicht sogar verdient hatten. Die, die Schüler hassten, die sich ihnen gegenüber unmöglich benahmen. Ich hatte mir daher keine Gedanken gemacht, hatte geglaubt, dass ich nichts zu befürchten hätte von diesem Vandalen. Unter den respektierteren Lehrern galt der Vandale als namenloser Rächer, und darin schwang durchaus ein wenig Genugtuung, denn nicht nur die Schüler, auch die Lehrer, die ein besseres Verhältnis zu ihren Schülern pflegten, hatten darunter zu leiden, wenn sie mal wieder aufgefordert wurden, sich zu den rassistischen, frauenfeindlichen Sprüchen zu äußern, die ihnen um die Ohren gehauen worden waren.
Jetzt war also auch ich dran.
Es kränkte mich schon, hatte ich doch immer das Gefühl oder zumindest die Hoffnung gehabt, fair und verständnisvoll zu sein. Wer sollte es auf mich abgesehen haben? War ich so schlimm wie Herr Meier, der ständig anzügliche und ausländerfeindliche Witze machte oder wie Dr. Börner, der Kinder nur anbrüllte und sie als minderwertig bezeichnete?
Was hatte ich mit diesen Leuten gemein? Welcher Schüler hatte es wohl auf mich abgesehen? Was hatte ich ihnen getan?
Weit und breit war kein Mensch mehr auf dem Schulgelände zu sehen. Auch der Hausmeister nicht, der sonst immer irgendwo werkelte.
Es war kein so riesiges Problem.
Einen Reifen bekam ich noch gewechselt. Ich hatte das schon gemacht, aber ich war eben müde und hatte mich auf eine heiße Wanne und ein paar Nudeln gefreut.
Es blieb mir nichts anderes übrig, als mich selbst um die Angelegenheit zu kümmern. Also seufzte ich und legte los. Ich holte den Ersatzreifen und den Wagenheber aus dem Kofferraum und versuchte die Radmuttern zu lösen, bevor ich den Wagen aufbockte. Ich kannte die Routine. Ich hatte es als Ehrensache empfunden, einen Reifen wechseln zu können, um nicht so hilflos dazu stehen.
Als ich irgendwann aufsah, sah ich Liz, die auf ihrem Hollandrad vor der Schule hin und her fuhr.
Wie so eine Leopardin, die aus der Entfernung eine Herde Antilopen umkreist, unschlüssig, ob sie nun eine reißen soll oder nicht.
Das war zumindest mein erster Gedanke.
Es hatte etwas Raubkatzenhaftes, wie sie dort herumfuhr. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass dies ein Zufall war.
Aber hatte sie meinen Reifen zerstochen? Ich konnte es mir nicht vorstellen. Was hatte ich ihr getan?
Ich versuchte sie zu ignorieren und widmete mich meiner Arbeit und der fest sitzenden Radmutter. Wahrscheinlich sah es schon albern aus, wie ich auf dem Kreuzschlüssel rumsprang, vor allem, da ich auch nicht wusste, in welche Richtung ich die Schraube eigentlich zu drehen hatte.
Aus den Augenwinkeln sah ich immer wieder, wie sie da herum radelte. Sie schien mich nicht zu beachten, zumindest tat sie so, und ich tat so, als beobachte ich sie nicht.
Schließlich löste sich die Schraube, ich drehte sie los, wusste nun, in welche Richtung ich drehen musste und bekam auch die anderen drei Schrauben schnell gelöst und bockte das Auto mit dem Wagenheber auf.
Irgendwann hörte ich, wie sie angefahren kam. Ich unterbrach meine Arbeit, wischte mir einen Tropfen Schweiß von der Stirn und eine Strähne aus dem Gesicht und sah sie stumm an.
Sie war zu mir gekommen, dann sollte sie auch das Gespräch beginnen. Ich jedenfalls war weder in der Stimmung noch vorbereitet auf Smalltalk.
Sie hielt sich nicht mit einer Begrüßung auf und kommentierte auch nicht meine Arbeit oder den Reifen.
„Sie haben gestern ziemlich schuldig geguckt."
„Was?"
Sie stieg vom Rad, kam zu mir und lehnte sich an den Kotflügel, obwohl der in der Luft hing.
Ich sorgte mich ein wenig, dass sie den Wagenheber wegknicken könnte.
„Gestern, als ich Sie gefragt habe, ob sie mich verfolgen. Da haben Sie ziemlich komisch aus der Wäsche geglotzt. Als hätte ich Sie ertappt."
Die Position war seltsam. Ich kniete da vor meinem Wagen und sie stand über mir. Ich musste zu ihr aufschauen, als ich antwortete.
„Oh, das meinst du", ich versuchte beiläufig zu klingen. „Ich glaube, das bildest du dir nur ein."
Ich tat, als kümmerte ich mich um den Wagen und schaute sie nicht an.
„Das glaube ich nicht!"
Ihre Stimme war eine Nuance härter geworden.
Ich sah zu ihr auf. Dieser Höhenunterschied, auf der unsere Kommunikation ablief, war nicht gut. Ich so zu ihren Füßen, aufschauen müssend. Dazu noch angestrengt und verschwitzt, während sie die Lässigkeit in Person war.
Und doch hatte das auch etwas Wahres. Eine Schwere erfüllte jedenfalls meinen Rumpf, als ich aufstehen wollte, um diesen Positionsunterschied wett zu machen. Irgendwas in mir wollte mich zurückhalten, in dieser untergebenen Position belassen. Ich musste jedenfalls etwas in mir überwinden, um aufzustehen.
Aber als ich dann stand, auf Augenhöhe mit ihr war, da fühlte ich mich auch nicht wirklich anders, nicht überlegen. Ich schob es auf meine Verfassung, meinen Anblick, den späten Nachmittag. Aber ich wusste, dass ich mir etwas vormachte.
„Ich wollte Sie in Ihrer Arbeit nicht stören. Machen Sie nur weiter!"
Die Frage, ob sie wirklich so naiv und schlecht erzogen war, stellte sich mir nur für den Hauch einer Sekunde. So unaufmerksam konnte niemand sein. Sie hatte mir ganz bewusst ihre Hilfe nicht angeboten.
Ich sah sie stumm an, und sie blickte kühl zurück. Der Schweiß stand auf meiner Stirn und meine Hände waren dreckig. Ich konnte sie nicht in die Tasche stecken, ich konnte sie nicht in die Hüften stemmen, ich konnte die Arme nicht vor der Brust verschränken. Ich wusste nicht wohin mit ihnen und fühlte mich unwohl und unangemessen.
„Also, was sagen Sie?"
„Wozu?"
„Sie haben mir nachgestarrt."
„Wie gesagt. Das musst du "
„Ist ja auch egal, ob Sie es zugeben oder nicht." Ihre Stimme klang ungeduldig, doch als ich nicht sagte, was sie hören wollte, machte sie eine lange Pause, in der wir uns stumm gegenüberstanden.
„Wissen Sie, ich habe Sie auch beobachtet. Länger schon als Sie mich, glaube ich."
Ich hatte plötzlich einen Kloß im Hals, ohne dass es dafür einen Grund gegeben hätte. Warum fühlte ich mich jetzt schon wieder schuldig?
„Und?"
„Ich denke, ich weiß, was Sie an mir so interessiert."
„Wie gesagt, du musst dir da was einbilden."
„Ok, hören Sie zu!"
Wieder diese Ungeduld.
„Ich muss hier nicht stehen. Ich habe extra auf Sie gewartet, um mit Ihnen zu sprechen. Sie brauchen es ja nicht zuzugeben, aber dieses ständige Leugnen nervt mich langsam. Wenn Sie nicht hören wollen, was ich Ihnen zu sagen habe, dann ist das Ihre Entscheidung. Aber was ich Ihnen sagen wollte, hören Sie nur hier und jetzt, und wenn Sie noch einmal leugnen, dann bin ich weg, und Sie werden es niemals hören."
Mein Verstand sagte mir, dass ich jetzt einzuschreiten hatte. Mein Verstand sagte mir, dass ich mir diesen Ton nicht gefallen lassen durfte. Ich musste sie zu Recht weisen. Als die Ältere, als die Lehrerin, als die Respektsperson. Das war die gleiche Situation wie vor wenigen Wochen im Gang. Ich musste mich von ihr doch nicht herumkommandieren lassen! Ich musste mir von ihr doch keine Ultimaten stellen lassen!
Aber das war nicht der Moment der Ratio. Sie drohte mir, dieses Spiel, oder was immer es war, zu beenden. Das konnte ich nicht zulassen. Ihre Drohung traf mich. Die gleiche Macht, die mich vor ihren Füßen verharren lassen wollte, hielt mich zurück, das Spiel zu beenden. Sie gewann wieder. Ich wollte hören, was sie zu sagen hatte, was sie anzubieten hatte.
Also sah ich sie stumm an. Ohne Widerworte und schicksalsergeben.
„Na also. Geht doch. Sie finden irgendwas an mir, sonst würden Sie mir nicht so nachstellen. Ich seh's in Ihren Augen. Ich bin geradeheraus und offen und so. Und Sie suchen so jemanden wie mich."
Sie hatte recht, so wenig ich mir das eingestehen wollte.
„Ich habe auch über Sie nachgedacht. Ich glaube, es würde mir Spaß machen, Ihnen das zu geben, was sie so dringend brauchen."
Sie sah mich an.
Ihre Stimme hatte sich geändert. Sie klang jetzt ernst und seriös, sprach wie eine Erwachsene.
„Und was suche ich deiner Meinung nach?"
Der Frosch in meinem Hals ließ mich ein wenig krächzen. Dabei wollte ich doch neutral und unbeeindruckt klingen.
Sie sagte nichts, sondern trat einen halben Schritt näher und starrte mich an. Mit diesen grünen Augen. Funkelnd. Ich weiß nicht, ob sie sich auf Zehenspitzen stellte oder ich unwillkürlich zusammensank, jedenfalls war da wieder dieser Größenunterschied.
Dieser Unterschied in der Hierarchie.
Ich blickte wieder zu ihr auf, und was ich ihren Augen entnahm, entsprach all meinen Sehnsüchten. Diesen neuen Sehnsüchten, die ich bisher nie gekannt hatte.
Dann zerschnitten ihre Worte leise diesen Moment:
„Das weißt du ganz genau."
Es war ein beschwörendes und gehauchtes Flüstern, ich erkannte, dass sie mich duzte, dass sie Grenzen überschritt, aber es waren die, die ich überschritten sehen wollte.
Da war etwas. Es war etwas Dunkles. Ich konnte es nicht sehen, ich roch es allenfalls. Es roch schwer und animalisch, nach Moschus vielleicht. Ein schwerer Duft. Ich hätte es nicht in Worten ausdrücken können. Damals nicht, und ich glaube, Liz konnte es auch nicht. Sonst hätte sie es formuliert. Sie war geradeheraus und druckste nicht herum.
Mir fiel keine Antwort ein. Was konnte ich erwidern? Aber sie erwartete eine Replik.
Es gab eine richtige Antwort. Eine klare Antwort:
„Nein! Was bildest du dir ein? Wer bist du? Was nimmst du dir heraus? Was glaubst du, was ich riskiere? Was immer du meinst, ist falsch!"
Und doch erschien am Horizont eine Armee der Visionen, die Unerhörtes versprachen. Die Schritte ihrer Stiefel im Gleichklang, die immer lauter in meinem Hirn widerhallten. Stark und unwiderstehlich.
„Gib dich ihr hin! Gib dich ihr hin! Gib dich ihr hin!"
So klang es im Rhythmus ihres Marsches.
Ich bekam Angst vor meinen eigenen Fantasien. Und dazu dieses Hämmern in meiner Brust.
„Gehorche ihr! Gehorche ihr! Gehorche ihr!"
Es war mein Herzschlag und all dieser Lärm in meiner Seele.
Das Vibrieren und Marschieren einer wohlorganisierte Armee. Einer Armee von dunklen Gestalten, die nach Moschus und heißem Schweiß stanken.
Sie verscheuchten die klaren Antworten der Moral, die in alten zerschlissenen Tuniken da standen und räsonierten. Blasiert mit grauen Haaren von Anstand faselten. Sie liefen watschelnd und degeneriert davon, verscheucht durch die übermächtige Armee am Horizont. Mit ihren grimmigen Blicken und einem Funkeln in den grünen Augen.